Alte Weinraritäten aus Rheinhessen auf Weltreise
Mit 1811er, 1857er und 1874er Weinraritäten die Zunge benetzt
Im Hinblick auf das 200. Jubiläum von Rheinhessen im Jahr 2016 befasst sich die Weinbruderschaft Rheinhessen mit der Geschichte des Weines und dokumentiert die weinkulturelle Entwicklung. Dabei finden die Weinbrüder- und Weinschwestern immer wieder nette Geschichten, die es Wert sind erzählt zu werden. Im Folgenden wird der außergewöhnliche Weg beschrieben, den einige Flaschen 1857er und 1874er Wein nahmen, um nach über 150 Jahren schließlich wieder zur Heimat zurückzukehren.

Foto: Horst Kasper
Bereits ein Jahr nach der Heirat gründete Caspar Joseph Dolles eine Weinhandlung, deren Hofreite 9550 Quadratmeter umfasste. Die Weinhandlung Dolles erzielte beachtlichte Preise, Ehrungen und Medaillen bei den Weltausstellungen in Wien und Chicago und bei Ausstellungen in Paris 1857 und 1872. Von diesem Weingut existieren unter anderem noch drei Flaschen Wein des Jahrganges 1811 und je eine Flasche der Jahrgänge 1857 und 1874 - wahre Raritäten, der 1811er ging als „Kometenwein“ in die Geschichte ein. Diese Weine heute zu verkosten, wenn auch nur in Fingerhutmenge, stellte eine Einmaligkeit dar.
Der 1811er ist in Westhofen gewachsen. Aus dem alten Kellerbuch geht hervor, dass sechs Ohm dieses Weines am 7. September 1853 für 435 Gulden pro Ohm vom Urgroßvater des Westhofener Winzers Julius Grünewald an das Weingut Caspar Joseph Dolles verkauft wurden. Die gesamten Nebenkosten für Küfer, Transport und so weiter betrugen 58 Gulden je Ohm. Der Wein lag also von der Ernte bis ins Jahr 1853 im Fass und wurde fachmännisch behandelt. Das Fass wurde immer „beigefüllt“, damit der Spund feucht blieb. Ohm kommt aus dem Lateinischen von „ama“, Eimer, ein altes deutsches Flüssigkeitsmaß, das bis Anfang des 20. Jahrhunderts für Wein mit unterschiedlichen Mengenangaben noch üblich war. Für Frankfurt am Main waren für ein Ohm 143 Liter festgelegt.
Nach dem Tode von Hermann Dolles, des Enkels und letzten Nachkommens von Caspar Joseph, erhielt Julius Grünewald drei Flaschen des 1811er Weines, da seine Ehefrau eine Verwandte, wenn auch nicht Blutsverwandte der Familie Dolles war.
Im September 2008 wurde der gute, alte 1811er neu verkorkt
Im September 2008 wurden diese Flaschen im Dienstleistungszentrum in Oppenheim neu verkorkt. Bei dieser Gelegenheit konnten Otto Schätzel und Horst Kasper einen Fingerhut dieser zwei Jahrhunderte alten Rarität verkosten. Sie nippten nacheinander an dem zäh fließenden, dunkelgelben Wein im Stengelglas. Otto Schätzel: „Starker Sherryton in der Nase, aber auch aromatische Vielfalt, erdig, holzig – aber sensationell, mehr als genießbar.“ Der Wein war gut gepflegt, das heißt, er wurde neu verkorkt und die Flaschen wurden „beigefüllt“.
Johann Wolfgang von Goethe lobte den „Elfer“ in höchsten Tönen, auch Ernst Theodor Amadeus Hoffmann ließ sich von seinem Verleger mit dem Ausnahmejahrgang bezahlen. Es sei der beste Jahrgang, der seit 100 Jahren gewachsen ist, zuckersüß und äußerst stark, schwärmten die „Alten“.
Die Flaschen der Jahrgänge 1857 und 1874 sind heute im Besitz von Horst Kasper. Sie haben eine lange Reise um die Welt hinter sich. Der Wein, in Bodenheim gewachsen, gepflegt, abgefüllt und verkorkt, ging als Erbmasse nach Namibia, wurde dann nach Südafrika verschifft und kehrte im Jahr 2010 nach Bodenheim zurück zu Horst Kasper. Die Weinflaschen waren ein Geschenk von Ernst Günther Becker, ein Neffe des Bodenheimer Weinhändlers Hermann Dolles. Auch diese beiden Flaschen wurden im DLR Oppenheim von Thorsten Eller sorgsam entkorkt und steril behandelt. Bernsteinfarbig-ölig floss ein kleiner Schluck ins Glas. „1857er, der beste Wein in diesem Jahrhundert“, so die Chronik, „nach Frühjahrssonne, heißem Sommer und ausreichend Regen“. Die verdunstete Fehlmenge wurde mit Riesling aus der Niersteiner „Glöck“ nachgefüllt und die Flaschen neu verkorkt.
Auch wenn bei dieser Verkostung nur die Zunge benetzt wurde, so war es doch ein erhabener, ein außergewöhnlicher Augenblick, den man nicht vergisst. Es ist etwas Einmaliges solch edle Tropfen verkosten zu dürfen.
Der Verfasser besitzt eine Fotokopie des Verzeichnisses „des Weinwachses von 1650 bis 1853“ von Mainz und der Umgegend, was man Rheinwein nannte. Der 1811er wird in diesem Verzeichnis so beschrieben: „Extra, extra gut und viel, was man viel sagen kann. Dieser Jahrgang übertraf alle guten Weine, die in 100 Jahren gewachsen sind. In einer anderen Aufzeichnung ist festgehalten: „Zehn bis 14 Tage zu früh gelesen“.
Horst Kasper – LW 9/2014

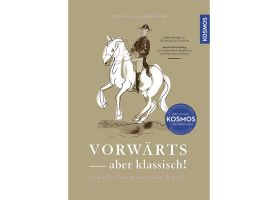
 .
.