Das Abenteuer „ökologischer Weinbau“ gewagt
In zwei unterschiedlichen Weingütern arbeiten
Es war eine interessante Veranstaltung von Bioland Rheinland-Pfalz-Saarland im Weingut Sauer in Landau-Nußdorf. Eingebettet in das Bioland-Weingut der Familie Sauer, die im Jahr 2021 in eine Halle und eine neue Vinothek aus natürlichen Materialien investierte, fand eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Zukunft von Landwirtschaft und Weinbau: Gesellschaftliche Erwartungen und politische Leitplanken“ mit Jan Plagge, dem Präsident des Bioland-Verbandes und Eberhard Hartelt, dem Präsidenten des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd statt.

Foto: Setzepfand
1. Im Kreislauf wirtschaften
2. Bodenfruchtbarkeit fördern
3. Tiere artgerecht halten
4. Wertvolle Lebensmittel erzeugen
5. Biologische Vielfalt fördern
6. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren
7. Menschen eine lebenswerte Zukunft sichern in Regionen, für die Gesellschaft, auf den Höfen.
Er bemerkte auch, dass sich Praktiker in der Politik engagieren müssen, um die Ziele der Landwirtschaft vor Ort umzusetzen. Plagge, der seit über fünf Jahren zudem Präsident der EU-Gruppe der Internationalen Bio-Landbaubewegung (IFOAM EU) ist, ist viel in Brüssel unterwegs und berichtete von sehr deprimierten italienischen, spanischen und französischen Winzern. Das System sei am Ende.
Hartelt stimmte zu, dass diese große Unzufriedenheit der Grund für die Traktordemos im vergangenen Jahr war. Anlass war die Agrardieselstreichung. Er betonte, dass der Deutsche Bauernverband bereits signalisierte, dass er zur übernächsten GAP weg von den Direktzahlungen möchte. Er schlug vor, das ZKL-Papier zurate zu ziehen, das die Landwirte für Umwelt- und Artenschutzleistungen honoriert. Noch gebe Deutschland viel Geld für Naturschutz aus, doch meist bleiben über 50 Prozent der Gelder in Planungsbüros oder wissenschaftlichen Institutionen stecken. „Tatsächlich umgesetzt wird nur wenig. Es sei denn, es sind Projekte, die leider zu klein und befristet angelegt sind.“ Es müsse möglich sein, Kompensationsgelder für die Umweltleistungen der Landwirte einzusetzen und es müsse das natürliche Potenzial vor Ort genutzt werden, um den Arten- und Naturschutz auf den Flächen auszuweiten. Beispiele seien die Projekte Modell Kooperative Donnersberg oder FRANZ.
zep – LW 43/2025

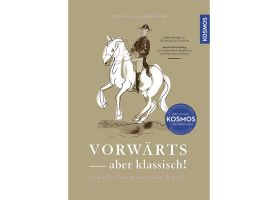
 .
.