Agrarumweltmaßnahmen im Ackerbau
EULLa-Antragsverfahren läuft bis 17. Juli
Das aktuelle EULLa-Antragsverfahren bietet Landwirten in Rheinland-Pfalz eine interessante Auswahl an Agrarumweltmaßnahmen, die sie auf ihren Ackerflächen umsetzen können. Christian Cypzirsch vom DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück stellt die Ackerbau-Programmteile der neuen Förderperiode vor.

Foto: Cypzirsch
Die Verträge in den einzelnen Programmteilen laufen jeweils vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2020 (fünfjähriger Verpflichtungszeitraum). Die Weichenstellung zur Umsetzung der Maßnahmen kann jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten notwendig sein. So ist eine Teilnahme am Programmteil „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“ bereits bei der Herbstaussaat 2015 zu berücksichtigen, während „Saum- und Bandstrukturen“ erst im Frühjahr 2016 angelegt werden müssen.
Gemeinsames Ziel aller Programmteile ist es, die Umweltverträglichkeit der Produktion zu erhöhen, die natürlichen Ressourcen zu schonen und die Artenvielfalt der Kulturlandschaft zu fördern und zu erhalten. Die Förderprämien decken die entstehenden Ertrags- und Qualitätsverluste beziehungsweise Mehraufwendungen des Landwirtes für die erbrachten Leistungen ab.
Bei den einzelnen Programmteilen wird unterschieden in „landwirtschaftliche Programmteile“ sowie den Vertragsnaturschutz (VN). Erstere haben in erster Linie den Schutz von Boden, Wasser und Luft zum Ziel, letztere beinhalten vorrangig die Schutzziele Biodiversität und Landschaftsbild. Maßnahmen im Vertragsnaturschutz werden immer mit einem Vertragsnaturschutzberater abgestimmt.
Programmteil „Vielfältige Kulturen im Ackerbau“
Ziel des Programmteils ist eine ausgewogene und vielseitige Anbaudiversifizierung, die im Vergleich zu rein ökonomisch ausgerichteten Fruchtfolgen durch den Anbau von Leguminosen zur Sicherung der Eiweißversorgung beiträgt. Weitere Zielstellungen sind eine Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch den Anbau von Humusmehrern, eine geringere Neigung zur Verunkrautung und Krankheitsanfälligkeit durch einen höheren Anteil von Sommerungen und weiteren Anbaupausen bei anfälligen Kulturen.
Die speziellen Vorgaben des Programmteils betreffen die Fruchtfolgegestaltung, welche sich aus mindestens fünf verschiedenen Hauptfruchtarten zusammensetzen muss. Der Anteil jeder Fruchtart muss bei mindestens 10 Prozent und darf höchstens bei 30 Prozent liegen. Mindestens 10 Prozent der Ackerfläche sind mit Leguminosen (-gemengen) zu bestellen. Kulturen mit einem geringeren Anbauumfang als 10 Prozent können zu einer Fruchtart zusammengefasst werden. Der Getreideanteil darf insgesamt maximal 66 Prozent der Anbaufläche ausmachen.
Sämtliche Informationen zu allen Programmteilen von EULLa einschließlich der Grundsätze, der Förderprämien und Kontaktadressen sind auf dem Internetangebot des DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück unter www.pflanzenbau.rlp.de zu finden.
Für Fragen stehe die DLR, die Kreisverwaltungen und die Naturschutz-Beratungskräfte (nur für die Vertragsnaturschutzprogramme) zur Verfügung.
DLRUntersaaten und Zwischenfrüchte über den Winter
Dieser Teil zielt vorrangig auf den Schutz des Bodens unter anderem über eine Stabilisierung des Bodengefüges sowie die Erhöhung der Bedeckungszeit des Bodens. So können Wasser- und Winderosion gemindert und zusätzlich Nährstoffe fixiert werden.
Die Anlage von Untersaaten und Zwischenfrüchten und deren Umfang kann vom Landwirt betriebsindividuell angepasst und kombiniert werden. Nicht alle Flächen mit Sommerungen müssen in den Programmteil einbezogen werden. Eine nicht wendende Bodenbearbeitung darf erst ab dem 15. Februar erfolgen.
Untersaaten und Zwischenfrüchte
Die Untersaat wird in eine Hauptkultur gesät. Sie muss sich nach der Ernte etablieren und im Winter den Boden bedecken, bevor in der nächsten Vegetationsperiode die folgende Sommerkultur angelegt wird. Nur dann kann die Prämie für diese Schutzfunktion gezahlt werden. Eine Nutzung der Untersaat ist erlaubt. Ein Beispiel wäre die Einsaat einer Gräsermischung im Frühjahr 2016 zwischen die Reihen eines Maisbestandes, wenn darauf im Anbaujahr 2017 eine Sommerung folgt. Nach der Ernte etabliert sich der Bestand und könnte im Frühjahr 2017 für einen Schnitt genutzt werden.
Die Zwischenfrucht vor Sommerungen muss bis spätestens 15. September des Vorjahres ausgesät werden. Für Antragsteller im Jahr 2015 mit dem Verpflichtungszeitraum 2016 bis 2020 bedeutet dies eine erstmalige Saat bis 15. September 2015. Dafür ist in 2020 keine Einsaat mehr erforderlich. Vorgeschrieben sind die verwendbaren Kulturarten sowie die Einhaltung der Mindest-Saatstärken. Die Saatgutmengen sind mit Einkaufsbelegen oder im Falle des Nachbaus mit Belegen der Treuhandstelle für Saatgut nachzuweisen. Im Gegensatz zu den Untersaaten muss der Aufwuchs auf der Fläche verbleiben, und auch eine Beweidung ist nicht zulässig.
Saum- und Bandstrukturen im Ackerbau
Bei den Saum- und Bandstrukturen handelt es sich um eine Art „Klassiker“. Diese (Blüh-) Streifen dienen Wildtieren und Insekten als Lebensraum, dem Schutz von Gewässern und erfüllen eine Vernetzungsfunktion von Strukturen im Landschaftsbild.
Die Programmteilnehmer verpflichten sich, auf höchstens 10 Prozent der Ackerflächen mindestens 5 und höchstens 20 m breite Streifen, oder ganze Schläge bis 1 ha mit einer vorgegebenen Begrünungsmischung einzusäen.
Bei der Anlage der Flächen gibt es drei Optionen:
- jährliche Neuanlage von einjährigen Mischungen (Wechsel der Flächen möglich)
- einmalige Anlage einer mehrjährigen Mischung (kein Flächenwechsel)
- Anerkennung vorhandener mehrjähriger Streifen (Folgestreifen, keine Neueinsaat)
Die Ansaat muss bei den mehrjährigen Mischungen bis zum 15. Mai des ersten Verpflichtungsjahres erfolgen, bei den einjährigen Mischungen entsprechend bis zum 15. Mai eines jeden Jahres. Auf den Flächen sind Düngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz verboten.
Die fachliche Anerkennung der Folgefläche erfolgt durch eine landwirtschaftliche Beratungskraft am zuständigen DLR. Diese kann auch bei der Auswahl der Mischungen beratend unterstützen.
Anlage von Gewässerschutzstreifen
Im Rahmen dieses Programmteils können Landwirte Schutzstreifen entlang von Gewässern erster, zweiter und dritter Ordnung anlegen. Hier bietet sich die interessante Option, Abstandsauflagen in der Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln mit einer Fördermaßnahme zu kombinieren. Gewässerrandstreifen dienen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und des neuen Landeswassergesetzes.
Dafür wurden fachliche Grundlagen erarbeitet, wobei es besonders sinnvoll ist, Gewässerrandstreifen anzulegen. Diese sogenannten Sondierungsstrecken für Gewässerrandstreifen sind bei den regionalen Ansprechpartnern der Wasserschutzberatung (WSB) sowie bei der Landwirtschaftskammer/den Verbänden abzurufen.
Die Breite der Streifen liegt bei mindestens 5 m und maximal 30 m. Die Aussaat (bis 15. Mai des ersten Verpflichtungsjahres) muss mit einer standortgerechten extensiven Grünlandmischung erfolgen. Der Gräseranteil in der Mischung muss mindestens 80 Prozent betragen und mindestens drei ausdauernde Gräserarten umfassen. Leguminosen dürfen nur zu maximal 20 Prozent in der Mischung enthalten sein.
Die Fläche ist mindestens einmal jährlich zu nutzen. Organische wie mineralische Düngung inklusive Kalkung sowie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist nicht zulässig.
Alternative Pflanzenschutzverfahren
Maiszünzlerbekämpfung: Um den Einsatz von Insektiziden im Mais zu reduzieren, besteht hier die Möglichkeit zur Förderung des Einsatzes der Trichogramma-Schlupfwespen zur Maiszünslerbekämpfung. Der Landwirt verpflichtet sich, jeweils bis spätestens zu Beginn der Eiablage des Maiszünslers die Trichogramma in der vom Hersteller angegebenen Aufwandmenge gleichmäßig auf der Fläche zu verteilen. Die Einzelflächen sind jährlich zu melden. Es dürfen keine Insektizide zur Maiszünslerbekämpfung eingesetzt werden.
„Vertragsnaturschutz Acker – Ackerwildkräuter“
Über diesen Programmteil (ehemaliges Ackerrandstreifenprogramm) werden standorttypische und gefährdete Ackerwildkräuter erhalten und in ihrer Entwicklung unterstützt. Die Auswahl geeigneter Flächen, wie auch die Ausgestaltung der Maßnahmen, erfolgt in enger Absprache mit der Vertragsnaturschutzberatung.
Auf den Ackerflächen können im Sommer- oder Wintergetreide 5 bis 20 m breite Ackerrandstreifen angelegt werden. Die ortsübliche Aussaatstärke muss auf den Streifen um mindestens 50 Prozent reduziert werden (maximal 200 Körner/m²). Dies kann zum Beispiel mit doppeltem Reihenabstand umgesetzt werden. Die somit entstehenden lockeren Getreidebestände ermöglichen die Keimung und den Auflauf der zu schützenden Ackerwildkräuter. Wird im Verpflichtungszeitraum auf dieser Fläche kein Getreide angebaut, kann der Streifen zweimal brach fallen, allerdings nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren. Vorgewende sind nicht förderfähig. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, eine mechanische Unkrautbekämpfung und die Düngung sind auf den Streifen verboten.
Vertragsnaturschutz (VN) Acker – Lebensraum Acker
Ein Hauptziel dieses Programmteils ist die Förderung von Kleinsäugern (zum Beispiel Feldhamster, Hase) und Vögeln (zum Beispiel Fasan, Rebhuhn, Lerche) auf Ackerland, die für ihre Entwicklung dünne Getreidebestände zur Deckung und zur Nahrungssuche bevorzugen. Als Zusatzmodul wird der Ernteverzicht angeboten.
Analog zu dem vorher beschriebenen Programmteil erfolgt die Auswahl geeigneter Flächen, wie auch die Ausgestaltung der Maßnahmen, in enger Absprache mit der Vertragsnaturschutzberatung und es können auf ausgewählten Getreideflächen 5 bis 20 m breite Ackerstreifen mit halber Aussaatstärke angelegt werden. Die Streifen können jedoch jährlich mit der Fruchtfolge wechseln.
Düngung und Pflanzenschutz sind nicht verboten, sollten aber auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden. Mechanische Unkrautbekämpfung ist zum Schutz der Gelege und Kleinsäuger nicht erlaubt.


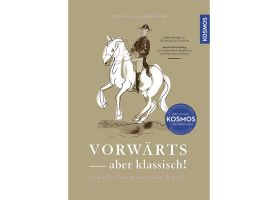
 .
.