Mit dem Zweinutzungshuhn Geld verdienen?
Legehennenzucht vor neuen Herausforderungen
„Die Legehennenzucht findet viel Interesse in den Medien, dabei geht es vor allem um Tierwohl und Tierschutz“, sagt Prof. Georg Erhardt, Universität Gießen. Auf der anderen Seite stehe das Ei der Legehenne unter massivem Preisdruck – „wie kriegt man das unter einen Hut?“, fragt Erhardt, und „wie reagiert ein internationales Zuchtunternehmen darauf?“ Zudem stehen Halter und Züchter vor neuen politisch festgesetzten Vorgaben, zuletzt der Beschluss des Landes NRW, das Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht zu verbieten. Antworten zu den aktuellen Fragen gab es kürzlich im Gemeinsamen Seminar der Nutztierwissenschaften der Universität Gießen von Dr. Matthias Schmutz, Genetiker bei dem Unternehmen Lohmann Tierzucht, Cuxhaven. Er sprach über „Neue Herausforderungen in der Legehennenzucht.“ Der Agrarjournalist Michael Schlag, Butzbach, berichtet.

Foto: agrarfoto
Die Geflügelzucht insgesamt bewegt sich aber aus Deutschland fort. Auch Züchter wie Lohmann mussten nach dem Käfigverbot ihre Haltung ändern und mit dem Umbau auf ausgestaltete Einzelvolieren „haben wir 50 Prozent unserer Kapazitäten verloren“. Diese würden im Ausland wieder aufgebaut, zum Teil in Kanada.
Obwohl es, abgesehen von einigen „Experimentallinien“ bei Lohmann nur diese vier Hauptlinien gibt, sagt Schmutz: „Die Diskussion um genetische Diversität sehen wir relativ entspannt,“ bestehe innerhalb der Zuchtlinien doch eine hohe genetische Variabilität. Legehennenzucht sei nämlich nie einseitig auf Leistung ausgelegt, sondern „wir selektieren auf viele Merkmale und die Population ist groß genug, dass wir auf alles reagieren können.“ Diese Vielfalt zeigt sich auch im globalen Angebot – für jede Weltregion gibt es das passende Huhn. In Deutschland mag man große Eier, hier beginnt die Vermarktungsklasse L ab 63 Gramm und der Eiererzeuger möchte Hühner, die ihm Eier der Kategorie liefern „wo es den guten Preis gibt“.
Mehr, aber dafür leichtere Eier für Markt in USA
Anders in den USA: Hier beginnt Klasse L bereits bei 58 Gramm, folglich „wollen die ein Huhn, das höhere Stückzahlen erzeugt.“ Dementsprechend werden sowohl die weißen als auch die braunen Lohmann-Hühner in einer Version „Lite“ angeboten „für Märkte, in denen kleinere Eier bevorzugt werden und die Wirtschaftlichkeit auf der Basis von Futter je Ei berechnet wird.“ So erzeugen die LSL in der Version „Lite“ in 72 Wochen zehn Eier mehr, die aber drei Gramm leichter sind. Dem Züchter ist es eigentlich egal: „Ein Huhn erzeugt Eimasse, der Rest ist Verpackung,“ sagt Matthias Schmutz; was zählt, ist die Syntheseleistung, auf wie viele Eier das Huhn sie verteilt, ist zweitrangig.
„Legespitze von 90 Prozent heißt: 10 Prozent machen Urlaub“
Foto: Schlag
Legepersistenz verbessern
Ein Zuchtziel für mehr Eier und konstante Produktion lautet „Verbesserung der Legepersistenz.“ Bekannt ist, dass die Legeleistung im Alter absinkt, früher rechnete man für eine normale Legeperiode 72 Wochen, heute sind es 80 bis 85 Wochen, die Leistungsdaten von Schmutz zeigen teilweise auch Werte bis zu 90 Wochen. Die gängige Auffassung, dass Hochleistungshühner zwangsläufig kürzer lebten, stimme nicht, im Gegenteil: „In Europa ist die Legedauer alle zwei Jahre um eine Woche länger geworden“, sagt Matthias Schmutz. Ziel ist es, das Abfallen der Legeleistung in diesen letzten Wochen weiter hinauszuzögern. „Das sind unsere alltäglichen Herausforderungen“, summierte Schmutz.
Daneben entstehen immer wieder neue Vorgaben für die Zucht durch neue Gesetzesvorschriften, auch durch eine neue kritische Verbrauchersicht auf die Produktionsmethoden der Branche. Politisch wird derzeit die Rechtmäßigkeit des Tötens männlicher Eintagsküken in Frage gestellt, das Land Nordrhein-Westfalen will ab 2015 das Töten der männlichen Küken gänzlich verbieten. Züchtung und Wissenschaft halten dafür allenfalls „Zwischenlösungen“ bereit, sagt Schmutz.
Geschlecht des Kükens schon im Ei bestimmten
So lässt sich zwar über eine Hormonbestimmung das Geschlecht eines Kükens bereits am neunten Bruttag im Ei feststellen, es gebe sogar „theoretische Ansätze am unbebrüteten Ei“, doch wie praxistauglich werden die Verfahren einmal sein? „Unter Laborbedingungen ist es möglich“, sagt Schmutz, „aber das auf eine Technisierungsstufe zu bringen mit vielen Tausend Eiern in kurzer Zeit und mit hoher Genauigkeit“, das sei noch eine Herausforderung.
Wenn man einstweilen nicht umhin kommt, den Schlupf zur Geschlechtertrennung abzuwarten, braucht man Konzepte zur Aufzucht und Vermarktung der männlichen Legehybriden. Der Beitrag zur Fleischerzeugung wäre übrigens gering – pro Jahr schlüpfen 40 Mio. Legehennen, aber mit 750 Mio. fast 20-mal so viele Mastküken. Selbst wenn man alle Bruderküken der Legehennen mit gleicher Mastleistung aufziehen könnte, würde das nur 4 bis 5 Prozent des Geflügelfleischbedarfs decken.
Was kann die Zucht zu dem Thema beitragen? Viel gesprochen wird über das Zweinutzungshuhn oder „Dualtier“ mit guter Legeleistung der weiblichen Tiere und guten Zunahmen und Schlachtkörpern der männlichen. Der Genetiker Matthias Schmutz hält das für eine wenig aussichtsreiche Idee, die Veranlagungen für Wachstum und Eier sind nämlich negativ korreliert: „Minus 0,4 – da kommt man züchterisch an eine Grenze“, sagt Schmutz.
Lohmann testete zwei verschiedene Kreuzungskombinationen von Mast- und Legelinien – „Dual 1“ und „Dual 2“. Als Vorteil des Verfahrens nennt Schmutz, „es ist schnell umsetzbar“, allerdings gebe es noch keine zielgerichtete züchterische Bearbeitung innerhalb der Ausgangslinien und die gleichzeitige Selektion auf Legeleistung und Wachstum „benötigt mehrere Generationen Zuchtarbeit.“ Ziel wären auf der männlichen Seite „Tiere, die man als langsam wachsende Broiler einsetzen kann.“
Welche Werte liefert nun der Mastvergleich von Brüdern der Legehennen „Lohmann Braun“ (LB) mit den männlichen Nachfahren der „Dualnutzung“ (DN)? Wenn sie nicht mehr als Eintagsküken getötet werden dürfen, entstehen sie ja als Koppelprodukt, das einen Ertrag erwirtschaften soll. Am 70. Tag, so die Ergebnisse von Lohmann, hat der LB-Hahn ein Lebendgewicht von 1,4 kg, der Doppelnutzungshahn wog bis dahin mit 3,0 kg gut das Doppelte. Die Futterverwertung des gemästeten Hahns aus der Legehennenzucht war mit 1 : 4 deutlich niedriger als bei der Zweinutzungszüchtung mit 1 : 2,5.
Allerdings: Weil der LB-Hahn ja auch viel leichter blieb, lag der absolute Futterverbrauch bei nur 5,5 kg, gegenüber dem DN-Hahn mit 7,5 kg. Nimmt man für den leichten LB-Hahn einen Erlös von 1 Euro an und zieht davon die Futterkosten von 2,20 Euro ab, dann bleibt für den Legehennenbruder am Ende der Mast ein Minus von 1,20 Euro stehen. Für den kräftigeren DN-Hahn nimmt Schmutz einen höheren Verkaufserlös von 3 Euro pro Tier an, das ist genau so hoch wie die gesamten Futterkosten, und so kommt der gemästete Hahn aus der Doppelnutzung schließlich auf ein wirtschaftliches Ergebnis von Null. Aber immerhin: „Der Dualhahn kann seine Futterkosten wieder reinholen“, sagt Schmutz, „dem LB-Hahn muss man 1,20 Euro dazu geben.“
Dual-Huhn setzt früh Fleisch an
Soweit der Blick auf die männliche Seite, wichtiger ist aber der Blick auf die Hennen und die ökonomische Bewertung der Eier. Wie bewähren sich die weiblichen „Lohmann Dual“ im Vergleich zu der spezialisierten Eierrasse Lohmann Brown (LB)? Auch dazu die Daten, die Matthias Schmutz im Seminar Nutztierwissenschaften präsentierte. Wichtig ist die Wachstumskurve der Tiere und die Entwicklung ihres Körpergewichts, also wohin lenkt es seine Syntheseleistung? Die LB-Hennen wachsen bis zur 28. Woche heran bis auf 2 000 Gramm, anschließend ändert sich das Körpergewicht kaum mehr, auch in der 68. Woche wiegt eine LB-Henne wenig mehr als 2 000 Gramm. Das Dualhuhn dagegen setzt schon früh mehr Fleisch an, ist in der 28. Woche bereits auf 2 500 Gramm angewachsen und wiegt in der 68. Woche über 3 000 Gramm.
Mehr Fleisch bedeutet weniger Eier
Mehr Fleisch bedeutet aber weniger Eier, wie die Entwicklung der Legeleistung der beiden Züchtungen in demselben Zeitraum zeigt: Die LB-Henne hatte in der 28. Woche gut 92 Prozent Legeleistung erreicht, und hielt diese in den folgenden Wochen lange aufrecht. Das Dual-Huhn brachte es in der 28. Woche zwar auch auf 85 Prozent, dann aber fiel sie stetig ab auf unter 50 Prozent Legeleistung in der 68. Woche – während ihr Körpergewicht in derselben Zeit ein Kilogramm zulegte. Entsprechend fielen die Produktionswerte der Legeperiode insgesamt aus. Die LB-Henne legte bis zur 68. Woche 290 Eier und verbrauchte dafür 120 Gramm Futter pro Tag. Der Futterverbrauch der DN-Henne lag mit 140 Gramm pro Tag deutlich höher – und sie lieferte dafür nur 250 Eier.
8 Euro Gewinn bei Legehenne, 2 Euro bei Zweinutzungshenne
Der wirtschaftliche Vergleich ist damit noch nicht abgeschlossen. Um die Kosten vollständig zu erfassen, rechnet Matthias Schmutz noch den höheren Futterverbrauch der Doppelnutzungshennen während ihrer Aufzucht dazu. Dann koste jedes Ei aus der Doppelnutzungshenne schließlich 220 Gramm Futter – gegenüber 158 Gramm bei der reinen Legehennenzucht. Ertrag minus Futter in Euro bewertet, bleiben bei der Legehenne schließlich 8 Euro Gewinn übrig, bei der DN-Henne aber nur 2 Euro (Erlöse 3 Euro niedriger, Futterkosten 3 Euro höher). Sollte sie trotzdem das gleiche Einkommen erwirtschaften, sind „2,5 Cent mehr Erlös je Ei von einer DN-Henne notwendig,“ so Matthias Schmutz. Er sieht keine Möglichkeit, das in der Massenvermarktung wieder hereinzuholen, räumt aber ein „in der Nischenvermarktung mag es anders sein“.
40 Prozent mehr Futter bei den Doppelnutzungshennen
Zwar habe sich bei den Hennenbrüdern gezeigt: „Die Mastleistung ist besser als erwartet“, aber die Hennen aus der Doppelnutzung hätten „pro Ei 40 Prozent mehr Futter verbraucht.“ Ein Nachteil der Doppelnutzung ist auch: „Je älter sie werden, um so geringer wird die Wirtschaftlichkeit“, die Differenz nach 68 Wochen beträgt bereits 40 Eier, die spezialisierten LB-Hennen sind dann aber noch keineswegs am Ende. Dem wichtigen Zuchtziel nach höherer Legepersistenz läuft die Doppelnutzung somit entgegen, ist die wirtschaftliche Haltungsdauer der DN-Hennen doch deutlich kürzer als bei den reinen Legehennen. Züchterisch ist die Idee von der Doppelnutzungsrasse ein Dilemma: „Was wir in die Verbesserung der Legeleistung der Weiblichen investieren, verlieren wir zum Teil wieder in der Mastleistung der Hähne.“ Im Übrigen: Die schlechtere Futterverwertung der DN-Hennen in Kauf zu nehmen, ist für Schmutz auch ein Widerspruch zum Ziel der Ressourcenschonung, laute das Gebot zur Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung doch, Produktivität und Effizienz der Nahrungsmittelproduktion zu steigern.
Aufzucht männlicher Küken mit Eierproduktion subventionieren?
Wenn es nicht mehr erlaubt ist, sich der männlichen Eintagsküken zu entledigen, muss der Vergleich von Legehennenzucht versus Doppelnutzung die männliche und weibliche Seite zusammen betrachten und das bedeutet: „Auf der männlichen Seite 1,20 Euro mehr, auf der weiblichen Seite 6 Euro weniger“. Welcher Weg ist für Hennenhalter unter diesen Voraussetzungen der Richtige? „Das Zweinutzungshuhn ist nicht die einzige Möglichkeit,“ sagt Schmutz. Er sieht einen anderen Weg: Wenn man auf Eier züchtet, hochleistende Hennen hält „und den männlichen 1,20 Euro dazugibt, kommt man am Ende billiger weg“. Die effiziente Eierproduktion müsse dann eben die Aufzucht der ungeliebten männlichen Nachkommen subventionieren. Das aber könne nur eine produktive Henne, denn „die Doppelnutzungshenne kann niemanden subventionieren, sie verdient selber nichts.“ Um die Verluste durch die Bruderhähne möglichst gering zu halten, empfiehlt er „die schlechte Futterverwertung auf möglichst kurze Zeit begrenzen“.
„Wo kein Markt ist, investiert niemand in einen Schlachthof“
Die Frage ist nur: „Wie alt müssen die männlichen Küken werden?“ Nur einen Tag, wie bisher, soll in NRW nicht weiter zulässig sein. Ansonsten heiße es dazu nur, so Matthias Schmutz: „Es muss genutzt werden“, was für ihn bedeutet: „Der Hahn muss so alt werden, dass er in einem Schlachthof geschlachtet werden kann.“ Und damit entsteht das nächste Problem in der Vermarktung, denn „wer schlachtet so kleine Tiere?“ Und wer möchte die kleinen Masthähnchen überhaupt kaufen? Konkurrieren sie auf dem Fleischmarkt doch mit den viel größeren Mastbroilern, deren Ausbeute an Wert bestimmendem Brustfleisch auch noch höher ist. Matthias Schmutz befürchtet: „Wo kein Markt ist, investiert niemand in einen Schlachthof“. Einer Vorstellung erteilt der Genetiker aber eine vollständige Absage: „Eine züchterische Lösung, wo Männliche und Weibliche für sich wirtschaftlich sind, die gibt es nicht.“
Guter Preis für Schlachthennen in Südafrika
Einfacher wäre das alles möglicherweise in Südafrika, dorthin liefert Lohmann die ganz spezielle Züchtung „Lohmann Silver“. Sie produziert kleine braune Eier vorwiegend der Größe M und ist speziell an die Marktverhältnisse in Südafrika angepasst, „wo man einen guten Preis für Schlachthennen erzielt“. Wenn sie ein Lebendgewicht von 2,3 kg hat, dann „gibt es für den Preis der Schlachthenne eine neue“, sagt Schmutz, die wirtschaftlichste Kombination ist hier: „Hohes Körpergewicht, geringes Eigewicht.“
– LW 27/2014

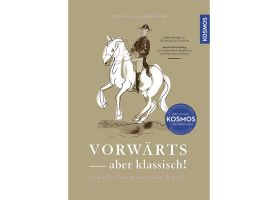
 .
.