Deutscher Grünlandtag in Heidenrod-Springen
Wie steht es um das Grünland in der kommenden GAP?
Das Grünland macht in Deutschland gut ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche aus. Erhalt und Pflege der Flächen sind weitestgehend abhängig von der Haltung von Wiederkäuern wie Schafen oder Kühen. Sie verwerten den für den Menschen nicht verzehrbaren Aufwuchs, pflegen die Landschaft und schließen Nährstoffkreisläufe. Die Budgetkürzungen für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2027, die im aktuellen Entwurf enthalten sind, machen wenig Mut. Denn die Haltung der Tiere ist teuer im Vergleich zur wirtschaftlichen Leistung, die sie erbringt und benötigt derzeit die Förderung.

Foto: Schön
Bundesministerium fürchtet Konkurrenz um die Gelder
Cornelia Berns, Unterabteilungsleiterin im Bundeslandwirtschaftsministerium (BMLEH), erläuterte die Haltung des Ministeriums. Die Eingliederung des Agrarbudgets in den Fond für nationale und regionale Partnerschaften (NRP-Fonds) stelle die Eigenständigkeit der GAP grundsätzlich in Frage.
„Wir hätten lieber ein eigenständiges Budget für Agrarpolitik und ländliche Räume“, erklärte Berns. Die Europäische Union (EU) befeuere damit den Wettbewerb um die Gelder und eine Schwächung der ländlichen Räume sei zu befürchten. Denn auch deren Entwicklung sei zusätzlich zur Fischerei, in diesem Fonds enthalten. Hier dürfe keine Konkurrenz entstehen. Die Kürzung des Budgets um ganze 20 Prozent sehe das BMLEH kritisch. Da die Mittel knapp bemessen seien, werde es eine große Herausforderung hier weiterhin gleiche Fördermöglichkeiten zu erhalten. Laut Berns sollen allerdings die Weidetierprämie, die Ausgleichszahlungen für benachteiligte Gebiete (AGZ) und die Junglandwirteförderung erhalten bleiben. Bisher sei es jedoch zu früh, um eine konkrete Ausgestaltung der künftigen Agrarpolitik in Deutschland und der EU zu diskutieren. Denn der Verhandlungsprozess um die künftige GAP ab 2028 dauere nach ihrer Einschätzung noch gut zwei Jahre.
Leistung des Grünlandes finanziell würdigen
Staatssekretär Michael Ruhl aus dem Hessischen Landwirtschaftsministerium (HMLU) mahnte den Rückgang der Tierhaltung in Deutschand nicht zu beschönigen. „Wir können das Grünland nicht ohne Tiere offen halten“, sagte er. Das sei nicht wünschenswert, da mit der Verbuschung des Grünlandes auch diverse Arten verloren gehen und damit auch die Biodiversität auf den Flächen. Die Weidehaltung passe zu den gesellschaftlichen Erwartungen an die Tierhaltung.
Auch deshalb setze die Landesregierung darauf, regionale Wertschöpfungsketten mit der Förderung von Grünland zu unterstützen. Nur über mögliche Leistungen des Grünlandes – beispielsweise als CO2-Senke – zu sprechen sei dabei nicht hilfreich, denn seine Bewirtschaftung müsse auch wirtschaftlich sein. Die Gesellschaft fordere von der Landwirtschaft Gemeinwohlleistungen und müsse diese auch honorieren.
„In dieser Hinsicht erfüllt uns die Budgetsenkung mit Sorgen“, sagte Ruhl. Sein Ministerium wolle das Zwei-Säulen-Modell in der GAP erhalten. Es sei wichtiger doppelte Strukturen zu beseitigen und Förderprogramme aufeinander abzustimmen. Durch die stärkere Nationalisierung der GAP seien die Länder gezwungen das jeweilige Agrarbudget stark aufzustocken. Angesichts der klammen Kassen sei fraglich, inwieweit die bisherigen Förderstrukturen erhalten werden können. Ruhl argumentierte außerdem, dass die Förderstrukturen wieder vereinfacht werden müssten. „Jeder Landwirt sollte den Gemeinsamen Antrag selbst stellen können“, sagte der Staatssekretär.
Von Deutschland gezahlte Gelder müssen ankommen
Für Karsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbandes (HBV), ist der aktuelle Entwurf zur GAP nach 2027 nicht tragbar. Der Strukturwandel in der Landwirtschaft sei speziell in Deutschland deutlich zu sehen. Es brauche politische Rahmenbedingungen, die zulassen, dass sich die Betriebe halten können. „Wir bekommen nur mehr Ökologie, Biodiversität und Betriebsnachfolger, wenn die Ökonomie stimmt“, bemerkte er. Deutschland sei der größte Nettozahler, liege bei der Verteilung des Agrarbudgets aber nur auf Platz drei.
Die geplante schrittweise Degression und Kappung der Direktzahlungen ist für den HBV nicht akzeptabel. Für viele Betriebe – nicht nur solche im Osten von Deutschland – führe das zu weniger Mitteln, die für die Zukunftsfähigkeit der Betriebe bitter nötig seien. Gerade große Betriebe und solche im Vollerwerb würden darunter leiden. Schmal stellte fest: „Bisher hat es jede GAP-Reform komplizierter gemacht.“ Die benötigte Planungssicherheit werde mit der neuen GAP vermutlich nicht geschaffen.
Zusätzlicher Inflationsausgleich nötig
Nicht annehmbar ist der aktuelle Entwurf zur GAP nach 2027 für Dr. Manfred Leberecht, stellvertretender Vorsitzender des Bundesverbandes Rind und Schwein. Die derzeitige Gestaltung sei für Landwirte schlicht untauglich. Er agumentierte zudem, dass die Budgetierung keinen Inflationsausgleich erfahren habe, dieser jedoch dringend notwendig sei. Zudem solle das Zwei-Säulen-Modell beibehalten werden. Die Ansprüche der Gesellschaft an Tierwohl und landwirtschaftliche Praktiken blieben mit knapperem Budget gleich. Die schnellen Politikwechsel der letzten Jahre seien auf den Naturraum und dessen Bewirtschaftung schlicht nicht übertragbar.
„Der landwirtschaftliche Sektor ist systemrelevant“, argumentiert Leberecht. Seit dem Ukrainekrieg werde außerdem über eine gemeinsame Verteidigungspolitik in der EU gesprochen. Solle diese umgesetzt werden, müsse die Ernährungssicherung und damit auch die Landwirtschaft ein fester Teil davon sein. „Verteilungskämpfe müssen an anderer Stelle geführt werden“, schlussfolgerte er.
Auch für den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbandes Rind und Schwein ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft und den ländlichen Räumen ein wichtiges Thema. Der GAP-Entwurf – besonders die enthaltene Degression – werde den Strukturwandel weiter beschleunigen.
„Es muss mehr Geld bei den Praktikern ankommen“
Simone Hartmann,Vorsitzende des Deutschen Grünlandverbandes, argumentierte, aus Sicht der Praktiker komme von den von Deutschland eingezahlten Mitteln in die GAP zu wenig an. Angesichts knapper Kassen bei Bund und Ländern sei zu befürchten, dass für Agrarumweltmaßnahmen – und damit auch für die Grünlandpflege – in Zukunft weniger Mittel zur Verfügung stehen. Auch die Ökoregelungen würden abgeschmolzen. In Thüringen seien zudem bereits die AGZ gekürzt worden. Dabei seien gerade diese Zahlungen für viele Betriebe wichtig und vor allem einkommenswirksam.
„Das kann so nicht weitergehen“, sagte sie und plädierte im Anschluss ebenfalls für einen Inflationsausgleich. Von der geplanten schrittweisen Degression und Kappung bei den Direktzahlungen hält Hartmann nichts. Sie erzählt, dass sie selbst einen Betrieb habe mit 1 000 ha Grünland und 35 Beschäftigten. „Das sind nicht nur meine Mitarbeiter, die von der Degression betroffen wären. Da hängen auch ihre Familien dran“, gab die DGV-Vorsitzende zu bedenken.
Im Anschluss an den Austausch der Verbände mit der Bundes- und Landespolitik übergab Hartmann zusammen mit Hans Hochberg, DGV-Vorstandsmitglied, ein Positionspapier mit den Forderungen der „Verbändeplattform Grünland“ zur Ausgestaltung der GAP nach 2027 (online verfügbar unter kurzlinks.de/fbcz). Der Plattform gehören 41 Verbände an, unter anderem deer DGV und der Bundesverband rind und Schwein.
AS – LW 42/2025

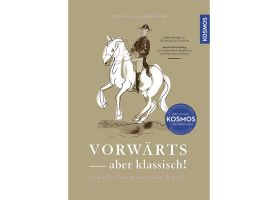
 .
.