Größere, aber feste Früchte sind das Ziel im Steinobst
Rheinhessischer Obstbautag in Nieder-Olm
Dr. Günter Hoos vom DLR Rheinpfalz fasste die Lage der Obstbaubetriebe in wenigen Worten zusammen: Die Betriebe werden noch größer, die Anbaufläche bleibt konstant und viele Betriebe geben den Obstbau auf. Wer bleibt, investiert in geschützten Anbau, in Bewässerung und gutes Personal. Nur wer all diese Bereiche abdeckt und noch dazu eine funktionierende Direktvermarktung verwirklichen kann, hat gute Zukunftschancen.
„Nach dem Frostjahr 2017, kam das Mastjahr 2018“, sagte Hoos und wies auch auf den Klimawandel hin, den die Obstbauern bei den Kirschen in Form eines engen Erntefensters und bei Zwetschen vor allem durch eine geringe Fruchtgröße erfuhren. Die Frostberegnung könne über den Bund gefördert werden, für die Genehmigung von Hagelschutznetzen wurde von den Mitarbeitern des DLR ein Leitfaden erstellt, der den Anbauern zur Verfügung steht. Zur Personalsituation am DLR bemerkte Hoos, dass der Personalabbau weitergehe.
Peter Hilsendegen, Obstbauberater am DLR Rheinpfalz in Oppenheim, führte durch das Programm. Als ersten Referenten begrüßte er Dr. Matthias Trapp vom Institut für Agrarökologie, RLP Agroscience aus Neustadt. Er sprach über die „Digitale Flächenkartierung obstbaurelevanter Standortfaktoren in Rheinhessen“. Trapp zeigte, dass derzeit als Open data – gemeint sind die kostenfrei zugänglichen Daten im Internet – das GeoPortal, FLO, Web-Dienste wie LGB, im Naturschutz LANIS sowie NatFlo und nun ganz neu das digitale Agrarportal den Landwirten zur Verfügung stehen. Das Besondere am digitalen Agrarportal ist seine Vielseitigkeit, hier wurden sehr viele Daten bereits gebündelt, die zuvor nur in einzelnen Portalen genutzt werden konnten. Als Beispiel nannte Trapp das Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturen (JKI), das bundesweit auf Basis von ATKIS-Daten auf Gemeindeebene existiert. Wenn in einer Gemeinde ein ausreichender Anteil an terrestrischen Habitaten vorhanden ist, kann die Wirkung von Pflanzenschutzmitteln durch schnelle Wiedererholung und Wiederbesiedlung sublimiert werden. Das bedeutet, in Gemeinden mit vielen Kleinstrukturen, müssen die Abstandsauflagen bei der Pflanzenschutzanwendung nicht eingehalten werden. „Das Problem ist, die meisten Obstbauern, Landwirte und Winzer wissen gar nicht, ob ihre Fläche im kleinstrukturierten Gebiet liegt“, sagte Trapp.
Diese Daten sind nun im digitalen Agrarportal zugänglich. Auch für die Anbauplanung von Weinbergen oder Obstbauflächen, kann das Portal wichtige Informationen liefern. Unter den Hinweisen Spätfrostgefährdung, Nmin-Referenzwerte, durchwurzelbarer Bodenraum und anderen können wichtige Hinweise für die betriebliche Planung genutzt werden. Wollen sich mehrere Landwirte oder Winzer zusammentun und die Vernetzung von Biotopen angehen, dann finden sie im Agrarportal den notwendigen Überblick. Selbst Satellitenkarten, die den Chlorophyllgehalt der angebauten Kultur zu einem bestimmten Zeitpunkt angeben, können eingesehen werden. „Doch Voraussetzung ist schnelles Internet“, fasste Trapp zusammen.
Frischverzehr von Obst wird bedeutender
Der Verbraucher möchte nicht nur mehr Umweltschutz auf den Agrarflächen, er möchte auch mehr Frischware zum Direktverzehr. Wovon die Strauchbeeren seit Jahren profitieren, das könnte doch auch im Bereich Steinobst verwirklicht werden, sagte Thorsten Espey von der Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau aus Weinsberg. Dort werden ähnlich wie in Dienheim, neue Steinobstsorten auf ihre Eignung für die Region getestet. Das Ergebnis vorweg: Die bisherigen Ergebnisse der ersten Ernten in den Jahren 2017 und 2018 sind noch zu vage, um verlässliche Aussagen zu machen. Angepflanzt wurden die Sorten Jule, Franzi, Myra, BayaAurelia, Miroma, Blue Frost, Jolina, Jofela, Joganta, Moni, Lotta und Emmi. Am vielversprechendsten gilt die Neuzüchtung Franzi. Die Kreuzung von Hanka mit Cacaks Frühe besitzt einen Hypersensibilitätsindex von Null, wurde in Weinsberg auf die Unterlage Weiwa gesetzt und reift fünf Tage früher als Cacaks Schöne und neun Tage später als Katinka. Die Steinlöslichkeit ist sehr gut. Sie sei eine große platte Frucht mit orangenem Fruchtfleisch, gutem Geschmack und ersten Erträgen im Jahr 2017. „Insgesamt macht sie einen guten Eindruck“, resümierte Espey für den Standort Weinsberg.
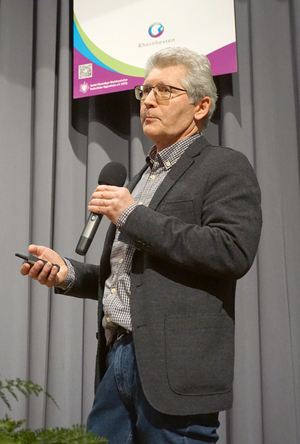
Am besten zum Brennen von Schnaps geeignet sei die Sorte Myra, eine Kreuzung des Zuchtklons 6482, einer Zwetsche, mit der späten Myrobalane, einer Kirschpflaume, von der Uni Hohenheim. Sie reift fünf Tage früher als Cacaks Schöne, und neun Tage später als Katinka. Die Steinlöslichkeit ist mittel, die Unterlage Wavit. Der Hypersensibilitätsindex liege bei Null. Espey nannte die Früchte sehr süß, vom Geschmack eher wie eine Zwetsche.
Über Maßnahmen zur Verbesserung der Fruchtqualität im Steinobst sprach Michael Zoth vom Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee aus Bavendorf. Ziel sei es, einerseits die Fruchtgröße zu steigern, aber die Festigkeit der Frucht zu erhalten. „Das ist eine Gradwanderung“, sagte Zoth. Sie haben verschiedene Versuche an Zwetschen und Süßkirschen gemacht. Dabei wurde in beiden Kulturen die mechanische Ausdünnung mittels Darwin-Maschine mit der chemischen Ausdünnung mit ATS in einprozentiger und zweiprozentiger Konzentration verglichen.
Ausdünnung im Steinobst bleibt schwierige Aufgabe
Die Ergebnisse in Zwetschen zeigten, dass einzig die Darwin-Maschine im Jahr 2018 den gewollten reduzierten Fruchtansatz brachte. Bei der Sorte Katinka waren die Einzelbaumerträge und die Fruchtanzahl trotz Ausdünnung zu hoch. Die starke Darwin-Maßnahme mit 160 Prozent, was bedeutet, dass mit 6 km/h und 250 Umdrehungen/min durch die blühenden Gassen gefahren wurde, sei der richtige Weg, resümierte Zoth. Die Darwin-Maschine brachte größere Früchte, jedoch in zu geringem Ausmaß, sodass laut Zoth weiterhin ein gutes Ausdünnungsprodukt für Zwetschen gesucht werde.

Auch in Süßkirschen versuche man stets noch größere Früchte durch längeres Wachstum, eine höhere Zellzahl und somit eine spätere Ernte oder durch Bewässerung zu erzielen. Die Früchte sollen dabei fest bleiben und eine dunkelrote Ausfärbung haben. An der Sorte Kordia wurden im Jahr 2016 fünf verschiedene Varianten 21 bis 14 Tage vor der Ernte getestet: Neben der Kontrolle wurden 5 g / 10 g / 20 g und 40 g des Phytohormons GA3 Wirkstoff/ha appliziert. Die Einzelbaumerträge und Fruchtanzahlen waren in allen Varianten recht gleichmäßig. Je höher die Aufwandmenge desto höher war das 100-Fruchtgewicht. 40 g GA3/ha steigerten das Fruchtgewicht und -kaliber signifikant. Je höher die Aufwandmenge, desto mehr waren die Früchte rot gefärbt. 40 g GA3/ha steigerte die Intensität der Fruchtröte signifikant.
Zoth folgerte, dass GA3 bei Kordia positive Ergebnisse brachte, die Fruchtqualität wurde gesteigert, die Fruchtdurchmesser wurden erhöht und die Festigkeit erhalten, teils verbessert. Die höhere Aufwandmenge von 40 g GA3/ha führte zu sicherer Qualitätssteigerung. Doch der Wermutstropfen: „Bisher ist GA3 noch nicht in Steinobst erlaubt.“ Insgesamt zog Zoth folgendes Fazit für die Ausdünnungsversuche: Dass die Behangregulierung in Zwetschen schwierig sei, dass die mechanische Ausdünnung Vorteile aufweise und dass eine schlanke Baumform, quasi eine Hecke, den Einsatz der Darwin-Maschine deutlich erleichtere.
zep – LW 7/2019


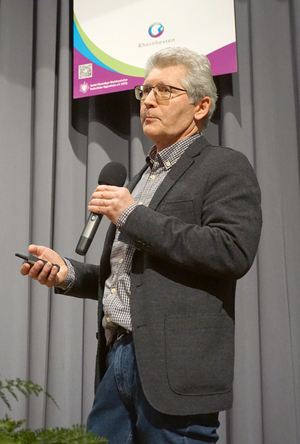



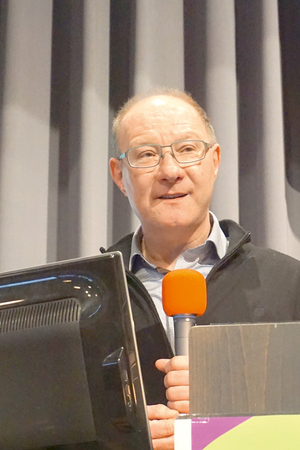

 .
.