Zwischen Innovation und Adaption
Wie fit ist die Forst- und Holzindustrie für den Wandel?
Wissenschaftler bewerteten die Branche als innovationsfreudig. Vertreter der Holzindustrie sahen dies anders. Das Thema des 36. Freiburger Winterkolloquiums Ende Januar lautete „Wandel, Innovation und Adaption in der Forst- und Holzwirtschaft.“ Dr. Christoph Wecht, Leiter des Competence Center Open Innovation am Institut für Technologiemanagement der Universität St. Gallen, erläuterte die Grundlagen: „Innovation ist, wenn der Markt Hurra schreit.“ Eine Innovation zeichne sich durch etwas Greifbares aus, etwas, was Bedürfnisse von Kunden erfülle.

Foto: Setzepfand
Christoph Wecht nannte ein Beispiel aus der Bauindustrie: „Der Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti beschränkt sich heute nicht mehr auf den Verkauf von Bohrern oder Akkusägen, sondern vermietet die meisten Geräte und übernimmt dabei die gesamte Baustellenlogistik für den Kunden. Der Kunde, sprich der Bauunternehmer, muss sich nicht mit der Abwicklung von Diebstahlschäden oder defekten Baugeräten herumschlagen. Er kann sich aufs Bauen konzentrieren.“ Hilti habe die Idee des Baustellenmanagements von anderen Dienstleistungsunternehmen übernommen.
Daten, Daten, Daten – hier liege größte Wertschöpfung
„Um einen solchen Service bieten zu können braucht man viel Informationen“, so der Wissenschaftler. Aus diesem Grund liege heute die größte Wertschöpfung in der Aufbereitung und der Interpretation von Daten.
Auch Prof. Dr. Charlotte Bengtson, Managing Director des schwedischen Forschungsinstituts Skogforsk räumte der Datenerhebung und dem Datenmanagement eine Schlüsselfunktion für die Zukunft der Forst- und Holzindustrie ein: „In Schweden gibt es jährlich etwa 200 Hiebe, dieses Rohholz wird an rund 1 000 Verarbeiter geliefert. Die wichtigsten Innovationen zur Steigerung der Produktivität betreffen deswegen die Logistik. Dazu braucht es Daten.“ Bengtson stellte den „route planner“ vor, ein in Schweden eingeführtes IT-System, das Fernerkundungs-, Ernte- und Logistikdaten vernetzt, und das über mobile Computer auf dem Harvester oder im Büro eingelesen und bearbeitet werden kann.
Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) stützen seit einigen Jahren ihre Forstplanung sowie ihre Holzernte- und Transportlogistik ebenfalls auf ein computergestütztes Datensystem. Martin Müller, Leiter der Logistik von BaySF, meinte dazu: „Dank unserer informatik- und datengestützten Optimierung der Logistik gibt es heute pro Jahr zwei Millionen weniger LKW-Leerfahrten als vor der Einführung unseres Systems.“
Der digitale Zwilling – Modell kopiert Realität
Weiter in die Zukunft blickte Prof. Dr.-Ing. Jürgen Roßmann mit dem Waldmanagementsystem „Virtueller Wald“ (www.virtueller-wald.net), welches sein Institut zusammen mit anderen Partnern für die Landesforsten Wald und Holz Nordrhein-Westfahlen modelliert hatte. „Der virtuelle Wald ist der digitale Zwilling des echten Waldes, also die virtuelle Kopie eines Waldmodells, so wie in der Industrie 4.0, wo Modelle neuer Maschinen oder Geräte heute mithilfe des Computers simuliert werden“, erklärte Roßmann.
Der Forscher, dessen Institut hauptsächlich Projekte für die Raumfahrt- und Industrierobotik entwickelt, erläuterte, wie er mit seinen Partnern den Virtuellen Wald aus 4D-Geodaten aufgebaut und mit Daten forstlicher und holzwirtschaftlicher Tätigkeiten kombiniert hatte: „Man kann Informationen über aktuelle Holzernte-, Pflanzungs- oder Pflegearbeiten eingeben und damit die Datenbank aktualisieren. Je mehr aktuelle Daten man in das System einspeist, desto vielfältiger werden die Anwendungen. Heute lassen sich Wachstumsprognosen durchführen und Holzhiebe planen. Der Virtuelle Wald entwickele sich immer mehr zum zentralen Kristallisationspunkt für die vielfältigen Prozesse im Wald.“
Die Anpasser – sie sind gezwungen sich zu verändern
„Die meisten von der Forschung angedachten Innovationen sind für die holzverarbeitenden Unternehmen derzeit kein Thema“, sagte der Geschäftsführer von Ilim Timber Europa, Carsten Döring. Der Präsident der AG Rohholzverbraucher und Geschäftsführer der Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal GmbH, Leonhard Nossol, ergänzte: „Innovation hat etwas Vorsätzliches, Adaption ist erzwungen. Die Holzindustrie betreibt Adaption, sie passt sich an wirtschaftliche Zwänge an.“ Die beschriebenen Adaptionsstrategien lassen sich in drei Punkte fassen: Den Rohstoff Holz effizienter nutzen, Betriebe ins Ausland verlagern und die Produktion reduzieren.
Grund für die beiden Rückzugsstrategien seien die Probleme der Rohstoffbeschaffung. „Rohholz ist in Deutschland zu teuer für Unternehmen, die sich mit ihren Produkten auf dem internationalen Markt positionieren müssen“, so Döhring.
Laut Leonhard Nossol sei in den letzten zehn Jahren jeder fünfte Betrieb der deutschen Holzwerkstoffindustrie verschwunden. Die übrigen kämpfen ums Überleben und die deutsche Holzindustrie habe in den letzten Jahren nur 40 Prozent der Abschreibungen reinvestiert. „Es müssten 100 Prozent sein“, meinte Nossol und erklärte damit, dass die holzverarbeitenden Unternehmen heute nicht einmal mehr ihre Maschinen erneuerten. Geld für Innovationen stünde kaum zur Verfügung.
Nicht mal die Maschinen werden in der Holzverarbeitung erneuert
Leonhard Nossols letzte Bemerkung klang besonders ernüchternd, vor allem gegenüber der Forderung von Christoph Wecht, laut welcher zukunftsträchtige Unternehmen Geld für Innovationen bereitstellen und notfalls auch verbrennen müssen, denn: „Wollen Unternehmen langfristig bestehen, müssen sie bereit sein, Projekte auf dem Innovationsfriedhof zu begraben, wenn sich diese als Flop erweisen. Wir brauchen eine Firmenkultur, die Fehler als einen Lernprozess akzeptiert.“
Neben unerwarteten Möglichkeiten kamen in Freiburg auch Innovationshindernisse zur Sprache. Prof. Dr. Steffen Kunz, von der Airbus GmbH in Friedrichshafen meinte: „Das Problem der Forstindustrie ist ihre geringe Größe und ihr hoher Anspruch an die Technik. Die forstliche Fernerkundung benötigt Technik, deren Entwicklung sehr teuer ist, die aber viel weniger Nutzer anzieht als etwa die Basisanwendungen von Google Earth. Dies treibt uns in ein wirtschaftliches Dilemma“.
Wie sehr Gesetze und Bestimmungen Innovationen behindern, wurde dem Publikum bewusst, als Charlotte Bergson über 74 bis 90 Tonnen schwere Holztransporte in Schweden sprach: „Solche Holzzüge helfen acht bis 20 Prozent Treibstoff zu sparen und stoßen weniger CO2 aus. Wenn wir schon Holz transportieren müssen, warum machen wir es dann nicht effizient?“
Im Zusammenhang mit dem Logistiksystem der BaySF brachten Vertreter der Forstwirtschaft die Themen Kooperation und Vertrauen zwischen den Akteuren der Holzkette zur Sprache. Christoph Wecht hatte zuvor in seinem Vortrag erklärt: „Erfolgreiche Unternehmen beziehen Zulieferer und Kunden in ihre Innovationsprozesse ein.“ Diese Aussage warf die Frage auf: Wem gehören die Daten? Die Herrschaft über die Daten entscheide über die Marktmacht, waren sich Referenten und Kongressteilnehmer einig.
Roßmann meinte: „In der Tat bezahlt der Nutzer die vermeintlich kostenlosen Serviceangebote von Google mit seinen Daten. Der Nutzer muss für sich abwägen, ob ihm dies die Vorteile der Angebote von Google Wert sind.“ Roßmann sagte aber auch: „Zentrale Datenhaltung bedeutet nicht automatisch, dass einer alleine Zugang zu den Daten hat.“ Datengenossenschaften oder Opensource-Systeme, bei denen jeder seine Daten einspeist und gleichzeitig Mitbesitzer der Daten ist, seien alternative Modelle. „Wir müssen die positiven Werte von Big Data hochhalten und den Missbrauch eingrenzen“, so Roßmann. Wie eine Warnung wirkte die Bemerkung von Christoph Wecht: „Es gibt sicher Leute, die sich bereits fragen, wie man die Daten aus der Forstindustrie nutzen kann. Diese Leute sitzen nicht hier im Saal.“
Ferdinand Oberer – LW 8/2016

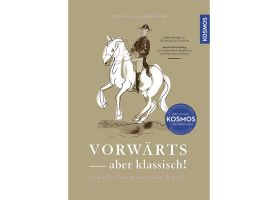
 .
.