Wer auf der Jagd versichert ist und wer nicht
Infotag der Landwirtschaftlichen Unfallversicherung in Melsungen
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (SVLFG) aus Kassel und die Arbeitsgemeinschaft Nordhessischer Jagdvereine informierten vorletztes Wochenende in Melsungen über die gesetzliche Unfallversicherung für Jäger. Weitere Vorträge widmeten sich der Sicherheit im Jagdbetrieb, den Gesundheitsgefahren sowie der Vorsorge und Prävention.

Foto: Michael Breuer
Revierinhaber ist versichert, sein Jagdgast nicht
Die Voraussetzungen für Leistungen durch die Berufsgenossenschaft sind dann gegeben, wenn ein Arbeitsunfall vorliegt, der bei einer versicherten Person einen Körperschaden durch einen Unfall verursacht hat, der infolge einer versicherten Tätigkeit erlitten wurde. Versichert sind nach dem Gesetz Eigenjagdinhaber und Pächter, wobei der Versicherungsschutz aber nur im eigenen Revier besteht. Ender wies darauf hin, dass im fremden Revier die Unternehmergemeinschaft verloren gehe. Versicherungsschutz besteht ferner für mitarbeitende Ehegatten und Partner, nicht nur vorübergehend mitarbeitende Familienangehörige und Beschäftigte wie angestellte Berufsjäger und bestätigte Jagdaufseher und Beschäftigte ohne Arbeits- und Dienstverhältnis wie Jagdhelfer, Jagdleiter und Treiber, wenn ihre Tätigkeit arbeitnehmerähnlich ist. Wesentliche Kriterien sind die Weisungsgebundenheit hinsichtlich Zeit, Ort, Dauer und Art der Arbeitsausführung, die dem Willen des Jagdunternehmers entsprechend durchgeführt wird und keine selbstbestimmte unternehmerähnliche Tätigkeit darstellt. Arbeitnehmerähnlich tätige Jagd- und Revierhelfer verlieren den Versicherungsschutz, wenn sie als Jäger tätig werden, das gilt dann auch für Treiber, wenn sie treibende Schützen sind, das heißt eine Waffe mitführen. Schweißhundeführer und Hundeführer, die ihre Dienste bei Drückjagden anbieten, gelten als eigenständige Unternehmer und sind damit ebenfalls nicht durch die LUV versichert.
Versicherungsfrei sind kraft Gesetzes Jagdgäste mit Jagderlaubnis oder auf Einladung des Revierinhabers. Die aus Passion ausgeübte Jagd stellt nach Ender kein in der LUV schützenswertes Motiv dar. Laut Gesetz gibt es auch keine Möglichkeit zur freiwilligen Versicherung in der LUV. Wird bei Revierarbeiten durch Jagdgäste oder Begehungsscheininhaber eine Jagdwaffe mitgeführt, stellt dies aus Sicht der LUV ein starkes Indiz gegen das Bestehen eines Versicherungsschutzes dar. Über die Leistungen nach Eintritt eines Versicherungsfalls und die Beitragsgestaltung bei Jagden in der LUV informierte Hartmut Fanck. Die Leistungen der LUV betreffen die ambulante und stationäre Heilbehandlung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft und Pflegegeld bei Haus- oder Heimpflege. Geldleistungen werden als Verletzten- oder Übergangsgeld bei Verdienstausfall, Renten an Versicherte bei eingeschränkter Erwerbsfähigkeit sowie Sterbegeld und Hinterbliebenenrenten gezahlt. An Beispielen erläuterte Fanck die Leistungen der LUV bei Jagdunfällen und Unfällen bei Revierarbeiten. Nach Fanck wurden 2015 in Deutschland insgesamt 13 576 742 Euro Aufwendungen für die Risikogruppe Jagdunternehmen geleistet. Dem stehe eine Deckung durch Versicherungsbeiträge von nur 7 343 940 Euro gegenüber. Da als politisches Ziel vorgegeben ist, dass identische Betriebe auch identische Beiträge zahlen sollen, ergibt sich für die Bemessung für 2015 ein Grundbeitrag von 75,28 bis 301,13 Euro und ein Beitrag, der risikoorientiert durch Zuordnung der Unfalllast die dargestellte Differenz ausgleichen muss.
Diskussion um den geeigneten Maßstab zur Beitragsbemessung
In der Diskussion zwischen SVLFG und den Jagdverbänden werden derzeit Beitragsmaßstäbe diskutiert, die letztlich vom Gesetzgeber abzusegnen sind. Denkbar seien auch Lösungen durch Privatversicherungen. Fanck gibt zu bedenken, dass diese ihre Leistungen ebenfalls an den Einnahmen orientieren werden und umgekehrt. Günstigere Gruppenprämien im Vergleich zu den Prämien für die LUV sind aus seiner Sicht nur bei Einschränkung der Leistungen vorstellbar. Heinrich Jungheim und Volker Dippel gingen auf Unfallgefahren im Jagdbetrieb und deren Verhütung ein. In den vergangenen sechs Jahren (2010 bis 2015) wurden aus Jagdunternehmen jährlich zwischen 468 und 597 Unfälle (überwiegend Stürze von Hochsitzen und Kanzeln) und ein bis fünf tödlich Verletzte gemeldet. Da die Verletztenbergung durch schwierige Ortsverhältnisse und Orientierungsprobleme behindert sein können, empfiehlt Jungheim sich mit den Kriterien der „Rettungskette Hessen-Forst“ vertraut zu machen.
Für Smartphones gibt es eine Rettungs-App „Hilfe im Wald“
Hierzu sei beim zuständigen Revierleiter der nächstgelegene zutreffende Rettungspunkt (Anfahrweg für Rettungsfahrzeuge) zu erfragen. Im Notfall sei dann die 112 anzuwählen und der Rettungspunkt zu nennen. Wichtig sei, vorher die Betriebsbereitschaft des Handys zu überprüfen. Für Smartphones gebe es auch eine Rettungs-App „Hilfe im Wald“. Der Referent ging auf die Unfallverhütungsvorschriften Jagd ein, wie sie auf der Rückseite der Jagdscheine aufgedruckt ist. Zu der Verantwortung des Jagdunternehmers zählt, dass er keine Personen mit mangelnder geistiger oder körperlicher Eignung beschäftigt, die Jagdteilnehmer zu Beginn der Jagd unterweist, die jagdlichen Einrichtungen regelmäßig überprüft und auf die Verkehrstüchtigkeit der eingesetzten Transportfahrzeuge achtet. Hochsitze müssten den baulichen Anforderungen genügen wie sie in den Broschüren „Sichere Hochsitzkonstruktionen“ der SVLFG beschrieben sind und von dort angefordert werden können (auch als Download auf www.svlfg.de). Jungheim brachte zahlreiche Beispiele guter und misslungener Ausführungen.
Die Leitersprossen müssen nach unten abgesichert sein
Unfallgefahren am Aufstieg liegen häufig an maroden Sprossen, die an den Holmen nicht nach unten abgesichert sind. Sollten Sprossen durch einfache Nagelung an den Enden aufspleißen, könne der Angriff durch Pilze schneller erfolgen und die Sprosse dann bei Belastung abbrechen. Zur Gefahr angesägter Holme durch Jagdgegner empfiehlt ein Revierinhaber die Holme rücklings mit der Motorsäge einzuschlitzen und ein Bandeisen einzutreiben. Grundsätzlich sei beim Aufrichten von Hochsitzen und Jagdkanzeln maschinelle Hilfe (Zum Beispiel Traktor mit Frontlader) menschlichen Bemühungen vorzuziehen und zum Beginn der Jagdsaison eine intensive Sicherheitskontrolle der Bauwerke vorzunehmen.
Worauf bei Gesellschafts- und Drückjagden zu achten ist

Foto: Dr. Ernst-August Hildebrandt
Schützen sollten bei ausbrechendem Wild den notwendigen Kugelfang berücksichtigen. Meist ist die Gefahr für Dritte durch Hochsitze, Kanzeln oder sonstige Erhebungen geringer. Bei einem Schusswinkel von 100 und 3 m hohen Ansitz wird das Projektil nach circa 50 m den Boden treffen, bei aufrechtem Stand bereits nach circa 20 m. Mobile Ansitzeinrichtungen, wie tragbare Hochsitze oder auf einem Transportwagen oder Pick-up seien hier sehr praktikabel. Die SVLFG biete für Jagden ein breites und kostenloses Serviceangebot. Darunter sind sicherheitstechnische Beratungen zu jagdlichen Einrichtungen, Hochsitzbaulehrgänge, Motorsägenlehrgänge und Vorträge bei Hegegemeinschaften und Jagdvereinen. Ferner werden Informationen für die Planung von Ernte- und Gesellschaftsjagden bereitgestellt.
Von Wildtieren übertragene Erkrankungen auf den Jäger
Arbeitsmediziner Martin Adelmann ging auf Gesundheitsgefahren bei der Jagd ein. Zu den von Wildtieren übertragbaren Krankheiten seien Borrelien, FSME-Viren, Hanta-Viren, Tollwut-Viren und der Fuchsbandwurm zu nennen. Die Borreliose sei die häufigste Erkrankung mit jährlich mehr als 50 000 Fällen und in ganz Deutschland verbreitet. Übertragen wird sie von Zecken, die sich in Laub, Gras und Sträuchern aufhalten (fallen nicht von Bäumen). Borreliose führt zunächst zu Unwohlsein und Fieber. Erkennbar zumeist an Hautrötungen, die sich ringförmig ausbreiten. FSME-Viren werden nach Befall durch Zeckenstich zunächst als „Sommergrippe“ wahrgenommen und führen später zu Hirnhautentzündung (Meningitis) und Hirnentzündung (Enzephalitis). Eine Schutzimpfung gegen FSME ist möglich. Die Erkrankung tritt bisher nur in Süddeutschland und im Kreis Marburg-Biedenkopf auf.
Hanta-Viren kommen weltweit vor
Zeckenabwehr ist durch gut bedeckte Haut möglich. Trotzdem sollte man den Körper nach Besuchen in Wald und Flur abgesucht werden. Hilfen stellen Zeckenzangen oder Zeckenkarten dar. Öl oder Klebstoff sollte nicht verwendet werden. Hanta-Viren kommen weltweit vor und verursacht ein hämorrhagisches Fieber. Der Krankheitsverlauf führt oft zu drei bis vier Tage andauerndem Fieber Hanta-Virus kommt weltweit vor. Die Übertragung des Virus erfolgt durch Mäuse und Ratten, wenn trockener Kot und Urin eingeatmet werden. Als Schutzmaßnahmen empfiehlt Adelmann Nagerbekämpfung in Gebäuden, Lüften, Einweghandschuhe tragen, die Entsorgung von Nagerkadavern und eine Intensive Desinfektion und Reinigung. Der Tollwut-Erreger (Rabies-Virus) zählt zu den gefährlichsten Erregern für Mensch und Tier. Die Inkubationszeit dauert in der Regel drei Wochen bis zu drei Monaten und wird durch Biss übertragen. Die Symptome gehen über eine Rötung der Bissnarbe zu Kopfschmerzen, Krämpfen und dem späteren Tod durch Lähmungen und Ersticken. Als Schutzmaßnahmen empfiehlt Adelmann, Tierkadaver nicht zu berühren und Kontakte zu verhaltensauffälligen Tieren zu meiden. Gefundene Impfköder sollte man nicht anfassen. Auf Schutzimpfung der Haustiere und Menschen sollte man achten, dies ist auch nach Kontakt noch möglich. Bei Reisen in exotische Ländern sollte besondere Vorsicht eingehalten werden.
Beim Aufbrechen von Wild auf Hygiene achten
Der Fuchsbandwurm schließlich kommt relativ selten vor (2001 in Hessen vier Fälle). In der Regel treten keine Frühsymptome auf. Eventuell kann er durch eine Sonographie im frühen Stadium erkannt werden. Grundsätzlich empfiehlt Adelmann den Jägern beim Aufbrechen des Wildes Einweg-Handschuhe zu tragen und Hände-Desinfektionsmittel zu verwenden, die auch Virenschutz bieten. Gegebenenfalls sollte eine Feinstaubmaske getragen werden und mit ungereinigten Händen weder gegessen noch getrunken oder geraucht werden. Wichtige Informationen zu Infektionskrankheiten und Impfempfehlungen können auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de) eingesehen werden.
Dr. Hildebrandt – LW 42/2016

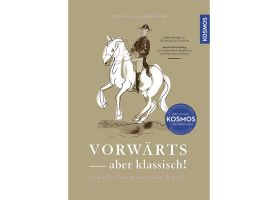
 .
.