Tabuthema Depression
Ein Thema für Landwirtsfamilien?
Depressionen gehören zu den häufigsten und hinsichtlich ihrer Schwere am meisten unterschätzten Erkrankungen. Laut Stiftung der Deutschen Depressionshilfe erkrankt jeder fünfte Bundesbürger ein Mal im Leben an einer Depression. Insgesamt leiden in Deutschland derzeit circa vier Mio. Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression, von der allerdings nur eine Minderheit eine optimale Behandlung erhält. Das mag daran liegen, dass die Erkrankung immer noch tabuisiert wird. Das LW fragte bei zwei Experten aus der Bad Wildunger Klinik Reinhardstal nach, inwieweit Landwirtsfamilien von dem Thema Depression betroffen sind. Der leitende Psychologe Klaus Döring und die Psychologin Doris Sause, zu deren Patientenkreis auch Landwirte und ihre Angehörigen zählen, geben im folgenden Interview hilfreiche Infos.
Foto: Klinik Reinhardstal
Doris Sause: Zu nennen sind zunächst einmal allgemeine Faktoren, die zwar nicht notwendigerweise zu Depressionen, aber dennoch zu hohen Stressbelastungen führen können. Durch den Strukturwandel in ländlichen Gebieten zeigt sich die wirtschaftliche Situation der Hofbesitzer als zunehmend angespannt, was diese häufig an die Grenzen ihrer seelischen Belastbarkeit bringt. Hinzu kommen weitere Belastungen wie das Zusammenleben in einem Mehrgenerationenhaushalt, das oft schwierige Thema der Hofübergabe und die Integration von Schwiegersöhnen oder Schwiegertöchtern, die meist aus beruflich anderen Bereichen mit ihren eigenen Vorstellungen auf den Hof kommen. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich auch daraus, dass in der Landwirtschaft betriebliche und wirtschaftliche sowie familiäre und beziehungsorientierte Belange nur schwer zu trennen sind, was im Problem- oder Konfliktfall das Zusammenleben zusätzlich belastet.
LW: Gibt es auch speziellere Ursachen für die Entstehung einer Depression?
Klaus Döring: Ja, zu den genannten Belastungen kommen spezifische Einflussfaktoren hinzu. Depressiv Erkrankte haben häufig eine starke zwischenmenschliche Bindung und reagieren sehr sensibel bei Veränderungen der sozialen Beziehungen, zum Beispiel bei Trennungen oder Verlusten. Die Fähigkeit, Konflikte und Spannungen im Miteinander auszuhalten, ist meist gering ausgeprägt. Der Betreffende identifiziert sich stark mit seiner Aufgabe, ist dadurch in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeengt, und meint, funktionieren und sich beweisen zu müssen. In kritischen Situationen kommt dann noch das Gefühl hinzu, die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren, es nicht mehr wirksam beeinflussen zu können. Wesentlich ist dabei, dass sich das Selbstwertgefühl eines depressiv erkrankten Menschen häufig als brüchig und instabil erweist, was mit einer hohen Empfindsamkeit auf Kritik oder Zurückweisung einhergeht.
LW: Wie wirkt sich die depressive Erkrankung eines Angehörigen auf das Familienleben aus?
Sause: Das Zusammenleben mit depressiv Erkrankten kann eine sehr deprimierende Erfahrung sein. Die familiäre Atmosphäre und das Wohlbefinden der Partner sind oft stark beeinträchtigt. Das passiert aufgrund der Symptomatik, zum Beispiel Interessensverlust, sozialer Rückzug oder Hoffnungslosigkeit, und auch aufgrund der dramatischen Rollenveränderungen, da der depressiv Erkrankte wesentliche Aufgaben im Beruf, der finanziellen Absicherung wie auch in den sozialen Bezügen nicht mehr wahrnehmen kann. Der gesunde Partner muss häufig die Verpflichtungen und Arbeiten des depressiv erkrankten Partners mit übernehmen, was nicht selten zu einer Überlastung führt. Untersuchungen verweisen darauf, dass etwa 40 Prozent der Erwachsenen, die mit depressiv Erkrankten zusammenleben, seelisch selbst derart belastet waren, dass bei ihnen ebenfalls eine Behandlung erforderlich gewesen wäre.
Foto: Klinik Reinhardstal
Döring: Als besonders belastend für die Angehörigen erweisen sich auch die unvorhergesehenen Stimmungswechsel und der soziale Rückzug des Betroffenen, was bei den übrigen Familienmitgliedern Unsicherheiten, aber auch Ärger und Schuldgefühle nach sich ziehen kann. Die Kommunikation und Nähe innerhalb des Familiensystems ist häufig stark beeinträchtigt. Hinzu kommen Verunsicherungen in Bezug auf die Lebensplanung und die finanzielle Absicherung der Familie aufgrund der Einkommensverluste bei längerer Erkrankung. Auch die massiven Schuldgefühle des depressiv Erkrankten und seine negative Sicht der Dinge sind für die Angehörigen oft schwer nachzuvollziehen. Weiterhin ist auch das hohe Selbstmordrisiko bei depressiven Patienten zu nennen, was die Angehörigen immer wieder unter den Druck setzt, aufpassen zu müssen.
LW: Wen sollte man kontaktieren, wenn man eine Depression hinter den Veränderungen vermutet?
Sause: Der Weg führt in der Regel zunächst zum Hausarzt, der den Betreffenden meist an einen Psychiater oder Psychotherapeuten verweist. Für die Familien bieten sich Kontakt- und Informationsmöglichkeiten über die örtlichen psychosozialen Beratungsstellen, die Landwirtschaftlichen Familienberatungen sowie insbesondere auch über das „Bündnis gegen Depressionen“ an. (Anmerkung der LW-Redaktion: Adressen finden Sie im Infokasten.) Die möglichen Unterstützungsmaßnahmen sowie informative Literaturempfehlungen für Betroffene und ihre Angehörigen sind dort umfassend aufgeführt.
LW: Wie lange dauert es, bis man einen Klinikplatz bekommt?
Sause: Die Akutbehandlung in psychiatrischen Krankenhäusern kann in der Regel direkt und unmittelbar durch den einweisenden Arzt veranlasst werden, eine psychosomatische Rehabilitationsbehandlung erfolgt in der Regel ebenfalls zeitnah, sie erfordert aber die vorherige Genehmigung durch den zuständigen Kostenträger, zum Beispiel der Landwirtschaftlichen Alterskasse.
LW: Wer übernimmt in der Zeit die Arbeit auf dem Hof und im Haushalt?
Sause: Es gibt die Möglichkeit für die Dauer der Rehabilitationsmaßnahme über den Betriebshilfsdienst einen Betriebshelfer oder gegebenenfalls eine Haushaltshilfe zu beantragen. Die entstehenden Kosten übernimmt die Landwirtschaftliche Alterskasse.
LW: Können Sie Beispiele von Patienten nennen, denen im Rahmen Ihrer Therapie in der Klinik geholfen werden konnte?
Döring: Ja, ich denke zum Beispiel an einen 56-jährigen Landwirt, der depressive Verstimmungen, Erschöpfungsgefühle und Kopfschmerzen beklagte. Er sei nur noch am Funktionieren und habe den Spaß an der Arbeit verloren. Er könne nicht abschalten, reagiere zum Teil aufbrausend, und aus sozialen Kontakten habe er sich weitgehend zurückgezogen. Eine neu angeschaffte Melkanlage, die nicht richtig funktioniere, habe ihm erhebliche Verluste eingebracht. Nach Vorhaltungen eines Vertreters, dass dies ausschließlich an seinen Bedienungsfehlern liegen würde, sei er dann ausgerastet. Danach habe er sich völlig zurückgezogen.
LW: Was passierte daraufhin in der Familie?
Döring: In der Familie wurde kaum noch miteinander geredet. Die Ehefrau zeigte sich angesichts der angespannten Haltung ihres Mannes zunehmend hilflos. Sie entwickelte Schuld- und Angstgefühle, zumal auch der 24-jährige Sohn aufgrund „der Sturheit und Aggressivität“ des Vaters den Hof zu verlassen drohte. Es entstand eine bedrückende und lähmende Atmosphäre. Erst durch die Initiative der nicht mehr im Haus lebenden 22-jährigen Tochter begab sich der Vater in Behandlung. Im Rahmen unserer Therapie wurde dann deutlicher, was den Landwirt derart verletzte, wenn er seine Kompetenz in Frage gestellt sah. Nachdem er etwas Distanz zu seiner prekären Situation gefunden und sein Selbstwertgefühl verbessert hatte, konnte er ansprechen, dass der Vater ihm nie etwas zugetraut und den Hof nur deshalb übergeben habe, weil der Bruder tödlich verunglückt sei. Das Gefühl, nur die „zweite Wahl“ zu sein, habe ihn nie verlassen. Sein Leben lang habe er unter dem Druck gestanden, sich beweisen zu müssen. Nun stehe er vor einem Scherbenhaufen.
Sause: Sein Gefühl des persönlichen Versagens konnte deutlich abgemildert werden, dies durch die Rückbesinnung auf seine Kompetenzen sowie auf die wirtschaftlichen Gegebenheiten, die sich seinem Einfluss entziehen. Er und die Familienangehörigen nahmen an unserem „Partner- und Angehörigenseminar“ sowie im Anschluss daran an mehreren Familiengesprächen teil. Es gelang ihnen, offen über ihre Sorgen und Belastungen zu sprechen, auch sogar darüber, den Hof eventuell aufzugeben. Die Aufgaben konnten klarer verteilt werden, was es dem Sohn möglich machte, sich wieder in dem Betrieb zu engagieren. Vereinbart wurde, auf „Warnsignale“ zu achten, regelmäßig miteinander zu sprechen und nicht mehr so lange zu warten, bis es nicht mehr geht.
LW: Was hat dem Landwirt nun konkret geholfen?
Döring: Zum einen sicher, dass er Distanz zu seiner betrieblichen Situation finden und sich in seinem Selbst- und Kompetenzgefühl stabilisieren konnte. Dazu trug bei, dass er den eigenen Druck, funktionieren und sich beweisen zu müssen, nun besser verstehen konnte. Er erlernte in einem speziellen Training, angemessen mit seinem Ärger umzugehen, was ihn stärkte. Durch die Einbeziehung der Familienangehörigen konnte zudem das gegenseitige Verständnis deutlich verbessert werden, Konflikte konnten angesprochen werden, das Gefühl, gelähmt und voneinander isoliert zu sein, löste sich auf. Zudem half ihm sicher auch die Akzeptanz und Wertschätzung, die er in der Gruppentherapie und auch im Kreise der Mitpatienten erfuhr. Die ökonomische Situation war natürlich unverändert kritisch – daran hatten die beschriebenen Gespräche und Klärungen nichts ändern können. Die Familie entschied sich dazu, weiterzumachen und zu hoffen, dass es klappt. Die Möglichkeit, den Hof gegebenenfalls auch aufzugeben, konnte zwar angesprochen werden, der Landwirt konnte und wollte sich mit diesem Gedanken aber nicht anfreunden. Dem Sohn eröffnete es aber die Möglichkeit, sich wieder auf dem Hof zu engagieren, aber, so seine Aussage, „nicht bis ans Ende meiner Kräfte.“
LW: In Ihrem Beispiel wird erwähnt, dass die Familie in eine gewisse Lähmung geriet. Was kann die Familie tun, um dies zu vermeiden? Wie kann sie den depressiv Erkrankten unterstützen?
Sause: Es wäre zunächst wichtig, Verständnis für die Situation des Erkrankten zu entwickeln und nicht zu versuchen, ihm die Symptome auszureden. Ebenso bedeutsam ist es, auf die Regelmäßigkeit der therapeutischen Maßnahmen zu achten, was sowohl die Besuche beim behandelnden Arzt und Psychotherapeuten sowie die regelmäßige Einnahme seiner Medikamente betrifft. Hinsichtlich der Gestaltung des Tagesablaufs ist es sinnvoll, den depressiv Erkrankten bei einer klaren Strukturierung des Alltags zu unterstützen, ihn zu Aktivitäten zu motivieren und feste Alltagsgewohnheiten beizubehalten, ihn zwar zu fordern, aber nicht zu überfordern, sondern Grenzen der Belastbarkeit zu akzeptieren. Von besonderer Bedeutung ist hier auch das Selbstmordrisiko: Sollte der Betroffene über Selbstmordgedanken berichten, ist es wichtig, dies ernst zu nehmen, ihm die Gelegenheit zu geben, sich auszusprechen und den behandelnden Arzt zu benachrichtigen.
LW: Wie kann man einer Depression vorbeugen?
Sause: Zunächst einmal, indem man angenehme Aktivitäten in den Alltag einplant, seine Freundschaften und soziale Kontakte regelmäßig pflegt, man sportlichen Aktivitäten nachgeht, sich selbst fordert, aber auch nicht überfordert, dass man bei auftretenden Problemen das Gespräch mit anderen sucht, statt sich zurückzuziehen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse im Blick hat, auf Warnzeichen achtet und rechtzeitig Hilfe in Anspruch nimmt. Die Fragen stellte Stephanie Lehmkühler
|
Informationen und Beratung
|




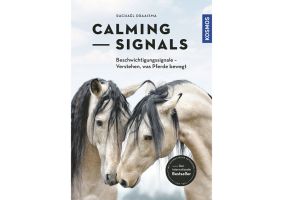
 .
.