Zwischenfrüchte, Sorghum und Körnermais
Rückblick auf den KÖL-Feldtag auf dem Bannsteinhof
Kürzlich veranstaltete das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) einen Feldtag zum Thema Zwischenfrüchte, Sorghum und Körnermais. Treffpunkt und Einstieg in den Feldtag Ende war die mit verschiedenen Zwischenfruchtgemengen eingesäte Demonstrationsfläche des Bannsteinerhofes in Zweibrücken Mörsbach.

Foto: K. Cypzirsch
Großer Versuch auf verschiedenen Standorten
Neben einer hofeigenen abfrierenden Mischung, bestehend aus verschiedenen Grob- und Feinleguminosen, Phacelia, Sonnenblume und abessinischem Kohl, standen zwei weitere Gemenge, die vom Kompetenzzentrum ökologischer Landbau (KÖL) bereitgestellt worden waren: TG 7 Aqua (Feldsaaten Freudenberger) und Geovital MS 100 LX (Bayrische Futtersaatbau). Hintergrund für die Auswahl der Gemenge war ein vergleichender Anbau von Zwischenfrüchten auf verschiedenen Standorten in ganz Rheinland-Pfalz. Torsten Feldt (KÖL) führte über die Demoanlage und diskutierte mit den Teilnehmenden verschiedene Aspekte des Zwischenfruchtanbaus wie zum Beispiel die Masse- und Wurzelbildung der verschiedenen Gemenge im Hinblick auf einen erfolgreichen Humusaufbau. Auch der Anbau von Zwischenfrüchten versus Untersaaten vor dem Hintergrund unsicherer Sommerniederschläge und der bestmöglichen Ausnutzung des Lichts durch die Kulturen wurde intensiv diskutiert. Ein weiteres Thema war die Drohnenaussaat von Zwischenfrüchten kurz vor der Getreideernte in den noch stehenden Bestand. Hier zeigten sich in diesem Jahr sehr unterschiedliche Etablierungserfolge, deren Ursachen bisher unklar sind. Ein wesentlicher Faktor ist das Belassen des Strohs auf der Fläche, um der keimenden Zwischenfrucht Feuchtigkeit und Abschattung zu bieten. Darüber hinaus wird die potenzielle Säure des Bodens als ein weiterer Faktor aktuell diskutiert. Die Einsparpotenziale der Drohnensaat wurde von den Teilnehmenden zwar als positiv beurteilt, jedoch die Kosten für Zwischenfruchtgemenge als zu hoch angesehen, um ein unsicheres Etablierungsverfahren anzuwenden. Für Betriebsleiter Marco Ruf kommt daher aktuell nur die Drillsaat in Frage.
Katharina Cypzirsch, DLR R-N-H – LW 42/2025

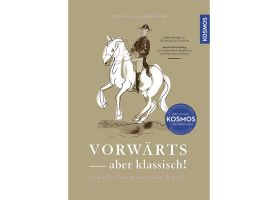
 .
.